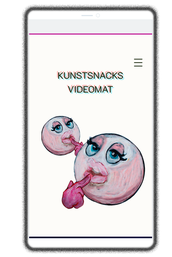Kulinarische Konfrontationen
Marion Tischlers „Kunst S:nack“
Eine Frau fährt mit einem mobilen Kiosk durch die Lande. Ihr Warenangebot ist speziell: Sie verkauft Kunst. Ihre eigene Kunst, von der Postkarte übers Multiple hin zum Unikat. Preisgünstig obendrein. Ist das nun ein Traum von Kundenorientierung oder ein Alptraum für den Kunstbetrieb?
Beklagt wird ja stets, dass Kunst auf einem hohen Ross säße, dass es Hemmschwellen gäbe, dass Kunst zu wenig mit den Menschen zu tun habe. Das ist mit Marion Tischlers Kunstkiosk nicht der Fall. Sie wollen nicht in eine Galerie gehen? Dann kommt die Galerie eben zu ihnen! Sie haben nicht genug Geld für ein Hauptwerk? Nehmen Sie doch ein preisgünstiges Multiple oder eine Postkarte! Das Prinzip „Kunstsnack“ ist so schlicht wie überzeugend: Kunst wird in kleinen, magenfreundlichen Portionen abgegeben und zwar in einer Umgebung, die gar nicht erst die Idee einer Hemmschwelle aufkommen lässt.
Die Kunst also als Billigheimer? Immer verfügbar, stets an den Wünschen des Kunden orientiert, aber nie in der Lage, ihn weiterzuentwickeln oder herauszufordern? Ist das nicht eigentlich ein Ausverkauf sämtlicher Ideale von Kunst als dem Refugium des Guten, Wahren und Schönen? Fest steht, dass Marion Tischler mit ihrem Projekt sowohl im klassischen Kunstbetrieb als auch in „kunstfernen“ Situationen merkwürdig unpassend wirkt. Die „Volksnähe“ ihres Auftritts macht noch einmal sehr bewusst, dass Hemmschwellen irgendwie doch noch immer zur Kunst gehören. Dem begegnet Marion Tischler mit der Ästhetik des Kiosks als Gegengift. Der Kiosk steht für schnelle Bedürfnisbefriedigung und eher weniger für die oberen Gesellschaftsschichten. Gleichzeitig scheint der „Kunstsnack“ abseits von Galerie- und Kunstorten eine Art Denkmal dafür zu sein, dass auch Kunst ernährenden Charakter haben kann. In solchen Situationen tritt Marion Tischler auf wie eine Erinnerung daran, dass Essen und Kunst nicht ganz unterschiedliche Systeme sind, dass beide Nahrung, Genuss, Überleben, aber auch schal, fad und ungesund sein können.
Wenn im Kunstkiosk die Klappen geöffnet werden, wird noch einiges mehr geöffnet: Ideen, Konzepte, Fragen dazu, wie wir uns unsere Kunst denn wünschen, und wie wir sie präsentiert haben wollen. Auch die Frage, was eigentlich ein Künstler ist, oder eine Künstlerin, gehört dazu, denn Marion Tischler tritt bewusst in der Rolle der Verkäuferin auf – und das ist sicher nicht der Teil einer Künstlerexistenz, der am beliebtesten oder angesehensten ist. Der merkantile Aspekt eines Künstlerlebens wird gern übersehen. Eine Frau, die persönliche Dinge verkaufen will und muss – eine konsequente Persiflage auf das Klischee der Künstlerin als entrückter Existenz, die keinen monetären Zwängen unterworfen ist. Darin liegt meiner Meinung nach der größte Mut dieser Arbeit. Es ist nicht das geniale Konzept einer mobilen künstlerischen Bedürfnisbefriedigung, es ist nicht das Warenangebot, es sind nicht die Werke, die auf unorthodoxe Art und Weise ihren Besitzer finden. Vielmehr ist es ein überraschender Kommentar zu den Dingen, die der offizielle Kunst-Diskurs ausspart: Welche Kunst ist die passende für den Kleinbürger? Welche Objekte, welche Ästhetik, welche Preisgestaltung greifen in einer Welt, die dem Museums- und Galeriebetrieb eher Skepsis als Begeisterung entgegenbringt? Tischler lockt ihr Publikum quasi-ästhetisch. Durch die gerade nicht künstlerische Gestaltung ihres Wagens, dadurch, dass sie sich an der Ästhetik von Werbung und realen Wurstwagen orientiert. Im Tierreich würde man von Mimikry sprechen. Aber sie lockt ihre „Opfer“ nicht, um sie anschließend zu verspeisen, sondern um sie zu füttern. Zwar nicht körperlich, aber doch geistig.
Mit Kunst kann man unterhalten. Das geht mit der Produktion von Kunst, aber auch mit ihrem Verkauf. Das Moment von Performance-Kunst hat mit den eigentlich zum Verkauf stehenden Werken im Grunde nichts zu tun. Zentral sind die Verkaufsgespräche, die Marion Tischler besonders schätzt, je länger sie dauern. Der künstlerische Austausch, das ist ihr besonders wichtig, geht nicht nur in eine Richtung, sondern ist wechselseitig. Der „Kunstsnack“ ist also kein Umschlag-platz großer Werte oder fulminanter philosophischer Ideen. Es kommen Menschen zusammen, und es wird der Umgang mit dem Unbekannten, dem Fremden, auf humorvolle Art und Weise geprobt. Menschen kommen zusammen und reden über Dinge, über die sonst nicht geredet würde. Für einige Leute kann Kunst vielleicht erstmals als etwas Greifbares wahrgenommen werden, etwas, das man sich sogar leisten kann. Es ist also gerade nicht „all about the money“. Hier fällt es nicht schwer, einen Bogen zu den Arbeiten des thailändischen Künstlers Rirkrit Tiravanija zu spannen. In seiner Variante der „Relational Art“, also der Kunst der Beziehungen, spielt ebenfalls das Essen eine zentrale Rolle. Seit den 1990er Jahren kocht er Suppe, Wokgerichte und Curries in den unterschiedlichsten Ausstellungssituationen. Er gibt damit ein eindeutiges Statement zur Bedeutung von Kunst: Kunst entsteht durch Interaktion, durch das Zusammenkommen unterschiedlicher Individuen und dem, was sich aus diesen Begegnungen ergibt. Als Sohn thailändischer Eltern, der in Argentinien geboren wurde, danach in Äthiopien, Kanada, den USA, Thailand und Deutschland lebte, ist das, was Kulturen verbindet, im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Im Kochen und Essen findet er seine Metapher, denn gegessen wird in allen Kulturen und das Spannende besteht darin, unterschiedliche Geschmäcker und Gewürze auf neue Art zusammenzubringen. Das kann zu Genuss aber auch Ekel führen. Die Kunst ist dafür das Geschmackslabor.
Vielleicht kann man Marion Tischlers Arbeit als eine deutsche Variante dieser Form von „Relational Art“ verstehen. Statt unterschiedlicher Kulturen aus Asien, Afrika, Europa oder Amerika kommen bei ihr unterschiedliche Milieus oder Sub-Milieus der deutschen Gesellschaft zusammen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob Marion Tischlers „Kunstsnack“ vor dem Berliner Marin-Gropius-Bau steht oder bei einem Osnabrücker Landfest. Es ergeben sich unterschiedliche Fragen an die Künstlerin, unter-schiedliche Erwartungen und letztlich unterschiedliche Bewertungen ihrer Person und Arbeit - von verrückt über cool bis zu peinlich oder stimulierend.
Der Kunstsnack ist die Weiterführung des Konzepts eines Kunstkaufhauses namens „Kunstkomet“, das sie 2003 mit Beate Lechler in Osnabrück konzipierte. Das Projekt sollte damals einen kreativ-produktiven Umgang mit dem Leerstand von Gewerberäumen propagieren und tat das auch erfolgreich, bis die „besetzte“ Immobilie schließlich abgerissen wurde. Dass daraus die Idee eines mobilen Kunstnacks erfolgte, ist geradezu bezwingend logisch. Diese entstand zunächst als nicht realisiertes Konzept für ein Stipendium im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel. Hier wird deutlich, dass der Kitzel, der Spaß hinter dieser Idee zunächst einmal anders angelegt war. Ganz theoretisch ging es um Fragen an das Distributionssystem der Kunst, um Kunst im öffentlichen Raum, um den Grenzbereich zwischen alltäglichen Verrichtungen und Performance. All diese Elemente waren sicherlich auch nach der Realisierung des Projekts weiterhin latent vorhanden. Allerdings nahm ihr Snackmobil dann hin und wieder auch eine unerwartete Wendung. Ging es in der theoretischen Auseinandersetzung zunächst um Fragen wie „Braucht es elitäre Orte, um Kunst zu vermarkten?“ oder „Gibt es einen Zusammenhang zwischen monetärem und ideellem Wert?“, ging es um die Vorstellung eines Kunstortes, der flexibler ist als die etablierten Plätze wie Museen und Galerien, stellte sich in der Umsetzung schließlich eher die Frage, wie Frau Tischler den Fängen des Ordnungsamtes entwischen konnte. Denn schließlich verkauft sie ja, treibt Handel, verdient und muss besteuert werden. Für künstlerische Feldforschung gibt es keinen Extra-Paragraphen. Ein Teil der künstlerischen Befriedigung Marion Tischlers bestand dann auch in dem „Kick“, mit ihrem Mobil nach einer Aktion mal wieder ungeschoren davongekommen zu sein. Hier bewegt sie sich dann also in einem künstlerischen Raum, der sie mit der Urban- oder Street-Art-Szene verbindet, was bei ihrem quietschig-spießigem Auftreten durchaus überraschend ist. Die Idee ist leicht, greifbar und hat dennoch eine gewisse Bitterkeit in sich: Wenn es für KünstlerInnen nicht genug Ausstellungsmöglichkeiten gibt und man dennoch nicht aus dem Blickfeld verschwinden möchte, dann muss man zu unorthodoxen Methoden der Sichtbarmachung greifen. Sie sagt damit natürlich auch: Seht her, welchen Stellenwert die Kunst in unserer Stadt hat, wenn die Künstler statt in schönen Ausstellungshallen in kleinen Kunstmobilen umherfahren. Doch statt larmoyant zu sein, macht Frau Tischler eben aus der Not eine Tugend und hat ihren Spaß am Austricksen des Systems.
Das einsame Herumreisen von Ort zu Ort, von Aktion zu Aktion trägt dann aber wieder die melancholischen Züge einer Zirkusexistenz. Die Künstlerin als „lonesome rider“, wie es dem Klischee entspricht, oder als künstlerisches Equivalent des „jungen Mannes, der zum Mitreisen gesucht wird“, wie man es von den Rummelplätzen kennt. Ein Leben, um das Volk zu unterhalten, ohne je ein Teil davon zu werden. Hier schließt sich der Kreis zur eingangs erwähnten Nicht-zugehörigkeit. Die Künstlerin als Fremdkörper in der Gesellschaft, das Kunstobjekt als Fremdkörper in der Fast-Food-Gesellschaft. Marion Tischlers Arbeit ist ein Spiel mit Bezügen. Diese Inkongruenzen auszuhalten und geradezu stolz sichtbar zu machen, scheint mir Marion Tischlers größte Leistung zu sein, ihr Glaube an die Versöhnbarkeit der unterschiedlichen Systeme, mit denen sie interagiert, wohl das sympathischste ihrer Arbeit. Eine Künstlerin, die Kunstproduktion, -distribution und -vermittlung zusammen denkt, die mit Wurst lockt aber einen Blick über den Tellerrand serviert. So ist sie wohl nicht nur Wölfin im Schafspelz oder Künstlerin in Kittelschürze, sondern oft auch eine rollende Verunsicherung.
Daniel Neugebauer 2011
Katalog
Kunstsnack - der mobile Kunstkiosk
Zur vergrößerten Ansicht auf das Bild klicken.
 Marion Tischler für Sie im mobilen Kunstkiosk unterwegs !
Marion Tischler für Sie im mobilen Kunstkiosk unterwegs !